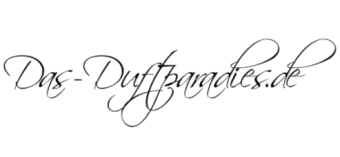Wie funktioniert riechen? Und warum ist unser Geruchssinn ein Instinkt, der uns beim Überleben hilft? Wie kann man unangenehme Gerüche entfernen? Lesen Sie spannende Artikel rund um die Olfaktorik und erfahren Sie mehr über die wichtige Funktion der Nase.
Über das Riechen
In erster Linie nehmen wir das Riechen als angenehm oder unangenehm, je nachdem, ob etwas gut oder unangenehm riecht. Wenn wir Parfüm auftragen, die Wäsche mit Weichspüler behandeln oder mit einem Raumduft für einen guten Duft in unserer Umgebung sorgen, geht es ausschließlich darum, unser Wohlbefinden zu steigern. Allerdings hat unser Geruchssinn eine viel wichtigere Funktion – denn Gerüche sollen uns signalisieren, ob eine Gefahr droht und wie wir uns dann verhalten sollen.
Grund dafür ist, dass Duftstoffe beim Riechen von der Nase aufgenommen und als Botenstoffe an unser Gehirn weitergeleitet werden. Das Gehirn wertet die Botenstoffe aus und nimmt blitzschnell eine Analyse vor, um uns anschließend durch körperliche Signale „Verhandlungsmuster“ vorzugeben.
Riecht etwas gut, möchten wir mehr davon. Riecht etwas schlecht, wenden wir uns ab.

Der Geruchssinn ist eine überlebenswichtige Funktion des Gehirns
Analysiert das Gehirn scheinbar gefährliche Gerüche, löst das Gehirn bestimmte Körperreaktionen aus. Um es mal an einem konkreten Beispiel zu erklären:
Riechen wir an einem verdorbenen Lebensmittel, reagiert der Körper mit Abwehr, beispielsweise durch Nase rümpfen, Übelkeit, Brechreiz.
In dem Moment, wo der Körper diese Reaktionen zeigt, wissen wir instinktiv, dass mit dem Lebensmittel etwas nicht stimmt und wir essen es nicht.
Gerüche aktivieren unser Alarmsystem
Ähnlich verhält es sich mit gesundheitsschädlichen Substanzen wie etwa Brandgeruch. Sobald wir ihn mit der Nase riechen, wird unser körpereigenes Alarmsystem alarmiert. Wir versuchen herauszufinden, woher der Brandgeruch kommt, werten aus, ob eine Gefahr besteht und wenn sie besteht, schüttet der Körper über das Gehirn Substanzen aus, die uns in Panik versetzen und einen Fluchtinstinkt aktivieren.
Angenehme Gerüche schaffen Geborgenheit und Lust auf mehr
Wie bei gefährlichen Gerüchen, wertet das Gehirn auch angenehme Gerüche aus und sendet das Signal „Ungefährlich, bitte mehr davon!“ Wenn Sie gerne Kaffee trinken und das Aroma von frisch gebrühtem Kaffee oder gerösteten Kaffeebohnen riechen, läuft Ihnen das Wasser im Mund zusammen und Sie bekommen sofort Lust auf eine Tasse Kaffee. Mögen Sie Vanilleduft und nehmen ihn wahr, fühlen Sie sich sofort geborgen und wohl. Riecht es nach frisch gebackenem Kuchen oder Ihrer Leibspeise, bekommen Sie sofort Appetit darauf und würden sich über eine Portion davon freuen.
Der Geruchssinn ist ein riesiger Datenspeicher!
Das Riechen ist also eine elementare Funktion unseres Gehirns, welches man sich ähnlich wie eine riesige Festplatte vorstellen kann. Es wertet nicht nur alle Gerüche aus, die wir wahrnehmen, sondern es speichert den Geruch und damit verknüpfte Ereignisse.
Ein gutes Beispiel: Ihre geliebte Oma hat früher einen Duftklassiker wie Gloria Vanderbilt oder Lancome Poeme getragen. Wann immer Sie dieses Parfüm riechen, wird Ihr Gehirn diese olfaktorische Wahrnehmung sofort die Erinnerungen an Ihre Oma wecken und an schöne gemeinsame Situationen erinnern.
Ein wahrgenommener Duft kann auch die Erinnerungen an einen tollen Ort oder eine negative Erfahrung wieder reaktivieren. Sie riechen Schilf und fühlen sich an einen Spaziergang am Meer zurückversetzt. Sie riechen ein Herrenparfüm oder Damenparfüm, dass der oder die Ex getragen hat und die Beziehung war toxisch? Dann fühlen Sie sich sofort in die Zeit von damals zurückversetzt und denken sich:
„Boah, das kann ich gar nicht riechen!“
Warum das so ist, liegt in dem riesigen Speicher unseres Gehirns begründet, welches Geruch, Ereignis, Ort, Mensch und Analyse miteinander verknüpft, speichert und die Auswertung zusammen mit Emotionen an den Körper sendet, wenn dieser eine bestimmte Duft wieder gerochen wird.
Beim Riechen sind Warnsignale stärker als positive Signale
Falls Sie sich fragen, warum Sie ausgerechnet Ihren Lieblingsduft immer weniger wahrnehmen oder den Eindruck haben, dass Ihr Lieblingsparfüm an Duftintensität zu verlieren scheint, gibt die Funktionsweise des Geruchssinns darauf die Antwort.
Erinnern wir uns: Das Riechen ist eine Körperfunktion, die uns vor Gefahren schützen oder uns signalisieren soll, dass alles in Ordnung ist.
Ganz einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass unser Gehirn bei ungefährlichen und besonders angenehmen Düften, die wir öfter riechen, das Alarmsystem deaktiviert und nicht mehr unsere Körperfunktionen steuert.
Warum wir bald unser Lieblingsparfüm nicht mehr riechen können
Leider bedeutet dies, dass angenehme Gefühle und positive Körperreaktionen immer mehr reduziert bis ganz ausgeblendet werden, umso häufiger wir einen tollen Duft wahrnehmen.
Daher ist es wichtig, vor allem das Lieblingsparfüm selten zu tragen und bei der Duftgarderobe auf möglichst viel Abwechslung zu sorgen.
Verwenden Sie Parfums der unterschiedlichen Duftrichtungen, die am besten keine Ähnlichkeit miteinander haben und bewahren Sie sich Ihren Lieblingsduft für besondere Anlässe auf, damit Sie ihn solange wie möglich immer wieder intensiv riechen können.
Zwischen dem Tragen sollten mindestens 3 bis 5 Tage liegen. Je länger die Abstände sind, desto besser.
Hilfreich ist ebenso, das Parfüm nicht auf das Dekolleté aufzusprühen, weil von dort aus der Duft permanent in die Nase und in das Gehirn aufsteigt. Viel besser geeignete Punkte sind die Handgelenke, bei langem Haar die Haarspitzen am Hinterkopf und die Kniebeugen. Von dort steigen die Duftmoleküle nur gelegentlich bis zur Nase auf.